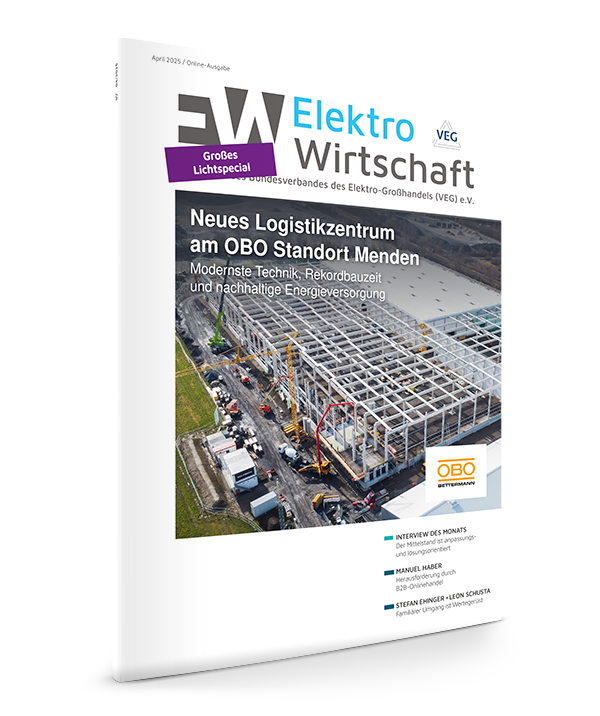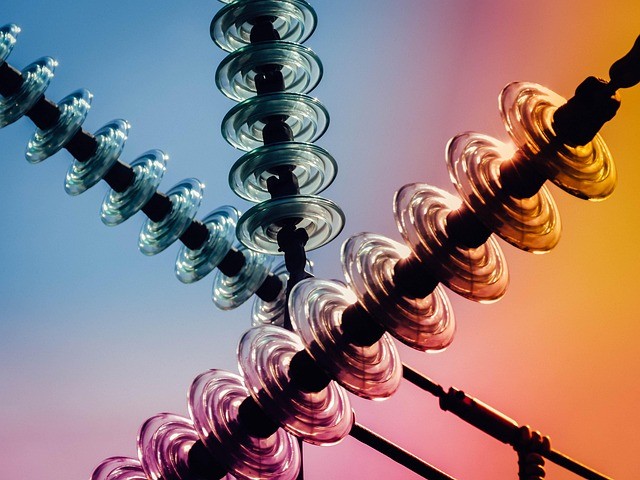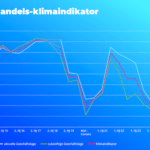Das Bundeswirtschaftsministerium lässt aktuell ein Monitoring zur Energiewende erstellen. Bei dieser Bestandsaufnahme ist auch der Stand der Versorgungssicherheit ein zentrales Thema – ein Bereich, in dem Deutschland weltweit führend ist. Mit der Transformation des Energiesystems müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Versorgungssicherheit langfristig auf Spitzenniveau zu halten. Insbesondere braucht es dringend mehr gesicherte Leistung in der Stromerzeugung und eine nachhaltig gesicherte und diversifizierte Versorgung mit Gas.
„Es ist richtig, dass das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monitoring zum Stand der Energiewende auch die Versorgungssicherheit als eine Grundlage seiner weiteren Arbeit überprüft”, erklärt Kerstin Andreae, die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. „Die Zuverlässigkeit der Versorgung in Deutschland ist im weltweiten Vergleich sehr hoch: Während im Jahr 2023 im Durchschnitt rund 13 Minuten der Strom ausfiel, waren es beispielsweise in den USA im Schnitt 367 Minuten. Auch bei einem steigenden Anteil von Strom aus Erneuerbaren Energien konnte das hohe Niveau in Deutschland in den letzten Jahren sogar noch gesteigert werden. Dies zeigt, dass die Leistungen der Netzbetreiber bei den Investitionen in Infrastruktur und Netzmodernisierung Früchte tragen: Ein Standortvorteil für Deutschland.
Eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit aufgrund strukturell fehlender Stromerzeugungskapazitäten spielte in Deutschland bislang keine Rolle. Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir jetzt vor allem schnell mehr steuerbare, gesicherte Leistung, etwa aus neuen (H2-ready-)Kraftwerken und Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie für begrenzte Zeiträume von Stunden bis einige Tage Pumpspeicherwerke und Batteriespeicher. Gleichzeitig müssen wir die Einbindung von Flexibilitäten systemisch und verstärkt angehen.
„Bis 2038 gehen geplant stetig steuerbare Stromerzeugungskapazitäten aus dem Markt, insbesondere Kohle- und alte Gaskraftwerke. Für ein funktionierendes Energiesystem brauchen wir daher neue steuerbare, gesicherte Leistung, um die Residuallast zu decken. Das sind etwa H2-ready-Gaskraftwerke, die vollständig auf den Betrieb mit Wasserstoff umstellbar sind. Damit der Kohleausstieg, wie geplant, weitergehen kann, müssen Gas-Kraftwerke schnell gebaut werden. Daher braucht es jetzt das Schnell-Boot: die Umsetzung des Kraftwerkssicherheitsgesetzes (KWSG). Die entsprechenden Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke und Gaskraftwerke müssen spätestens bis Anfang 2026 erfolgen, damit die Anlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen. Dazu sind eigentlich nur wenige, aber wichtige Anpassungen am bisherigen KWSG-Entwurf notwendig, um Investitionen rechtssicher auszulösen“, betont Kerstin Andreae. „Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Akzeptanz der Energiewende würde leiden, wenn die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet wird.“
„Zusätzlich brauchen wir in Ergänzung einen technologieoffenen Kapazitätsmarkt, der den Bau weiterer Kapazitäten, inklusive Flexibilitäten und Speichern anreizt, und auch den Bestand von Biogasanlagen, KWK-Anlagen und Wasserkraftwerken berücksichtigt. Dazu haben wir mit dem Integrierten Kapazitätsmarkt (IKM) einen Vorschlag erarbeitet, der auch mit einem funktionierenden KWSG harmonieren würde.
Neben dem Zubau von gesicherter Leistung zur Deckung der Residuallast ist zentral, dass der stabile Betrieb des Stromnetzes – durch die Bereitstellung der dafür notwendigen Systemdienstleistungen – gesichert werden kann“, sagt die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung weiter.
„Ein weiterer entscheidender Beitrag zur Versorgungssicherheit im Sinne der Resilienz, ist es, die Gasversorgung in Deutschland weiter zu diversifizieren. Abhängigkeiten von einzelnen Lieferländern gilt es zu vermeiden, um Produktions- und Lieferschwankungen ausgleichen zu können. Hierbei spielen auch Gasspeicher eine wichtige Rolle“, betont Kerstin Andreae weiter. Um die erhöhte Betroffenheit vom Spotmarkt mit seinen starken Preisschwankungen zu verringern, ist der Abschluss von Langfristverträgen zu unterstützen. Die von der EU gestalteten Rahmenbedingungen, beispielsweise durch die geplante Methanemissionsverordnung, müssen den Zugang zum Weltmarkt offenhalten und Langfristverträge weiterhin ermöglichen.
„Deutschland und Europa müssen weiter den Ausbau der Erneuerbaren Energien und verstärkt den Wasserstoffhochlauf vorantreiben, um klimafreundlicher, aber auch resilienter und unabhängiger zu werden. Hierzu braucht es einerseits einen bedarfsgerechten Ausbau der H2-Infrastruktur, für den auch Umwidmungen bestehender Gasnetze infrage kommen können. Zugleich gilt es auf EU-Ebene eine Wasserstoffallianz zu bilden, die sich für eine pragmatische und kosteneffizientere EU-Regulierung einsetzt. Dies fordern wir gemeinsam mit 13 weiteren Verbänden aus Energiewirtschaft und Industrie. Mit der richtigen Rahmensetzung auf EU-Ebene und einer verstärkten Zusammenarbeit von EU-Staaten kann der Wasserstoffhochlauf zu einer Erfolgsgeschichte werden“, ist Kerstin Andreae überzeugt.
Neben einem diversifizierten Import von Wasserstoff kann auch die Umwandlung von Strom aus Erneuerbaren Energien zur Resilienz der EU beitragen. Eine solche Nutzung von Wind- und Solarstrom führt dazu, dass Windenergie- und Solaranlagen in Europa in der Zukunft seltener abgeschaltet und diese Energiemengen übersaisonal als Moleküle gespeichert werden. Das kann weitere Importabhängigkeiten reduzieren und hält Wertschöpfung in der EU.