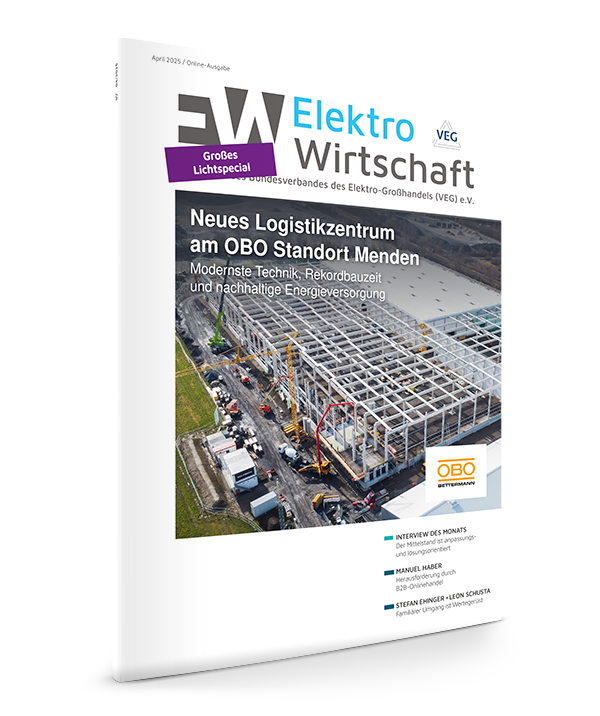Die Energiewende findet vor allem in den Verteilnetzen von Strom, Gas und Wärme statt. Die neue dena-Verteilnetzstudie zeigt, wie – angesichts knapper Ressourcen – Finanzierung, Planung und Digitalisierung effizient vorangetrieben werden können.
Neue Energieverbraucher und Erzeugungsanlagen, wachsender Investitionsbedarf und steigende Anforderungen brauchen neue Lösungen für die Energiewende im Verteilnetz. Die dena Verteilnetzstudie II legt eine betriebswirtschaftlich fokussierte Analyse vor und benennt vier zentrale Handlungsfelder für den zukunftsfähigen Umbau und Ausbau der Verteilnetze: Attraktive Investitionsbedingungen, koordinierte Planung, mehr Digitalisierung und spartenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern.
In der Studie wird ein Muster-Verteilnetzbetreiber einer für Deutschland repräsentativen Kommune modelliert. Die darauf basierende Analyse zeigt mittels betriebswirtschaftlicher Kennzahlen die Auswirkungen des Transformationsverlaufs auf Verteilnetzbetreiber und deren Handlungsmöglichkeiten auf. Die Studie entstand unter Federführung der dena, in Kooperation mit BET Consulting GmbH, der Bergischen Universität Wuppertal, BMU Energy Consulting GmbH sowie 26 Verteilnetzbetreibern. Sie setzt auf bestehenden Energiesystemstudien auf und ergänzt diese um eine betriebswirtschaftliche Perspektive auf die Transformation.
Corinna Enders, Vorsitzende der Geschäftsführung der dena, sagt: „Der Weg zur Klimaneutralität im Verteilnetz ist anspruchsvoll. Dafür müssen wir jetzt die richtigen strategischen Entscheidungen treffen. Es braucht einen verlässlichen Ordnungsrahmen, der Investitionen ermöglicht sowie Digitalisierung und Kooperation auf allen Ebenen. Genau hier setzt unsere Studie an.“
Vier zentrale Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft
Zentrale Erkenntnis der Studie: der wichtigste Baustein ist die Finanzierung. Eine erfolgreiche Transformation erfordert einen verlässlichen Ordnungsrahmen, der wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle ermöglicht und gleichzeitig Systemkosten senkt. Bei dem modellierten Muster-Verteilnetzbetreiber steigen die durchschnittlichen jährlichen Investitionen, verglichen mit dem Jahr 2024, spartenübergreifend bis 2045 um 85-123 Prozent. Netzbetreiber brauchen daher zusätzliche Kapitalquellen und aufgrund von Restriktionen in der Fremdfinanzierungsfähigkeit zusätzliches Eigenkapital. Ausreichend Eigenkapital zu beschaffen, kann bei hoher Investitionstätigkeit eine Herausforderung für Unternehmen sein. Hierfür gibt es verschiedene Lösungsansätze: eine Erhöhung des regulierten Eigenkapitalzinssatzes, strategisches staatliches Eigenkapital oder die Gründung externer Gesellschaften.
Eine koordinierte, möglichst früh zwischen allen Sparten und verschiedenen Ebenen verzahnte Planung ist das zweite zentrale Handlungsfeld für die effiziente Auslegung und den Ausbau der Verteilnetze. Um parallele Energieinfrastrukturen zu vermeiden, braucht es eine Fortentwicklung der Stromnetz- und Wärmeplanung hin zu einer Energieleitplanung mit einheitlichen Datenstandards. Entscheidend ist auch, dass EU-, Bundes- und Länderbehörden weiter bürokratische Hürden abbauen und Genehmigungsverfahren für den Netzausbau standardisieren und digitalisieren.
Drittens kann eine verstärkte Digitalisierung unterstützen, Energieinfrastrukturen vorausschauend und effizient zu planen und zu betreiben. Das bietet die Chance, durch Echtzeitdaten intelligenter Messsysteme über den Netzzustand die Versorgungssicherheit zu erhöhen, Prozesse zu beschleunigen und durch die gewonnene Transparenz den Netzausbau zu optimieren. Eine digitale Datenbasis verbessert zudem die Steuerbarkeit und die Prognostizierbarkeit, und sie erschließt Flexibilitätspotenziale. Dazu sollte eine dauerhafte Flexibilitätsnutzung ohne direkte Ausbauverpflichtung erlaubt und die Kosten der Digitalisierung anerkannt werden.
Das vierte Handlungsfeld setzt den Fokus auf die Energiewende als Gemeinschaftsaufgabe. Dies erfordert eine enge Kooperation aller beteiligten Akteure auf den verschiedenen Ebenen. Dafür muss die spartenübergreifende Zusammenarbeit der Verteilnetzbetreiber sowie die Zusammenarbeit mit externen Partnern weiter intensiviert werden. So können beispielsweise bei der Ressourcenbeschaffung regionale Zusammenschlüsse und Kooperationen helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auch könnte die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Startups verstärkt und die Bildung von Kompetenz-Clustern sowie Joint Ventures erleichtert werden.